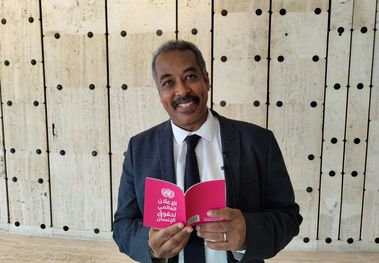Fluchtgründe
Eritrea ist eine repressive Diktatur; Menschenrechtsverletzungen sind an der Tagesordnung. Männer, Frauen und manchmal sogar Kinder werden in den Nationaldienst mit unbegrenzter Dauer zwangsrekrutiert und dort schweren Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. Aktuell sind mehrere Tausend Personen willkürlich und ohne Anklage sowie unter unmenschlichen Bedingungen in Haft, insbesondere Regimegegnerinnen und -gegner, Journalistinnen und Journalisten und Mitglieder religiöser Minderheiten. Berichte internationaler Organisationen dokumentieren, dass Deserteurinnen oder Deserteure und Wehrdienstverweigernde inhaftiert und gefoltert werden.
Laut dem UN-Sonderberichterstatter für die Menschenrechtslage in Eritrea, Mohamed Abdelsalam Babiker, hat sich die Menschenrechtslage in Eritrea mit Beginn des Krieges in der Tigray-Region im November 2020 und wegen dessen Folgen in verschiedenen Bereichen verschlechtert. Im ganzen Land hat die eritreische Regierung die Razzien intensiviert, um Personen, die sich dem Wehrdienst entziehen, aufzugreifen. Auch der Druck auf deren Familienangehörige, ihren Aufenthaltsort preiszugeben, hat zugenommen. Sie werden verhaftet oder ihre Wohnhäuser konfisziert. Im Zuge der Einberufung in den Militärdienst werden vermehrt wieder ältere Menschen und Jugendliche zwangsrekrutiert.
Bis heute gibt es keine unabhängigen und zuverlässigen Quellen, die eine Verbesserung der Menschenrechtssituation in Eritrea bescheinigen könnten.
Asylgesuche in der Schweiz
Laut den Angaben des SEM waren Eritreerinnen und Eritreer 2024 (Stand Ende Oktober 2024) mit 1733 registrierten Asylgesuchen die dritthäufigsten Gesuchstellenden. Dabei handelte es sich bei 744 Gesuchen um Primär-Gesuche und bei 988 Gesuchen um Sekundär-Gesuchen( Geburten, Familienzusammenführungen und Mehrfachgesuche. Primär-Gesuche sind unabhängig eingereichte Asylgesuche, während Sekundär-Gesuche die Folge eines bereits gestellten Gesuchs sind.
Praxis der Schweizer Behörden
Die Asyl- und Wegweisungspraxis der Schweizer Behörden gegenüber Asylsuchenden aus Eritrea hat sich seit 2016 verschärft: die illegale Ausreise und der drohende Einzug in den Nationaldienst führen nicht mehr per se zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft. Zudem halten die Schweizer Behörden den Wegweisungsvollzug nach Eritrea grundsätzlich für zumutbar.
Da es kein Rückkehrmonitoring gibt, bleibt in der Regel unbekannt, was mit Personen geschieht, die nach Eritrea zurückgekehrt sind. Ein Einzelfall konnte im Mai 2022 dokumentiert werden. Das Asylgesuch von «Yonas» wurde in der Schweiz abgelehnt. Nachdem er nach Eritrea zurückgekehrt war, wurde er verhaftet und gefoltert. Ihm gelang erneut die Flucht in die Schweiz, wo er auf sein zweites Asylgesuch hin Asyl erhielt. Der Fall verdeutlicht das Risiko, wenn trotz unklarer Informationslage Wegweisungsentscheide gefällt werden.
Unzumutbare Passbeschaffungspflicht
Eritreische Personen, die in der Schweiz als Ausländer*innen vorläufig aufgenommen worden sind, müssen für die Umwandlung des Ausweis F in einen Ausweis B regelmässig einen eritreischen Pass vorlegen (Härtefallbewilligung); ebenso zur Regularisierung bei negativem Entscheid mit Wegweisung. Dasselbe gilt für den Familiennachzug, für begründete Reisen, Eheschliessungen oder andere Zivilstandsänderungen. Falls sie keinen Pass besitzen, stellt das eritreische Generalkonsulat in Genf einen solchen aus – jedoch gegen Unterzeichnung einer sogenannten Reueerklärung und gegen die Abgabe von 2 Prozent des Einkommens, der sogenannten «Diasporasteuer». Mit der Reueerklärung müssen Eritreer*innen ein Schuldeingeständnis unterschreiben und ausdrücklich Strafmassnahmen deswegen akzeptieren, weil sie aus Sicht ihres Herkunftslands nationale Verpflichtungen nicht erfüllt haben. Zudem verlangen die eritreischen Behörden Auskünfte über ihre im Herkunftsland verbliebenen Angehörigen.
Die meisten eritreischen Personen in der Schweiz sind vor dem Regime im Heimatland geflüchtet, vor zeitlich unbeschränktem Nationaldienst, vor Zwangsrekrutierung und vor mehrjährigen Gefängnisstrafen unter schlimmsten Bedingungen. Es ist daher nicht zumutbar, von ihnen zwecks Passbeschaffung zu verlangen, die Reueerklärung zu unterzeichnen und dadurch zurückgelassene Angehörige und Bekannte zu gefährden sowie die Diasporasteuer zu bezahlen.
Vor diesem Hintergrund ist sehr erfreulich, dass das Bundesgericht in seinem am 20. November 2025 veröffentlichten Urteil 2C_64/2025 befand, dass es nicht zulässig ist, für den Erhalt einer Härtefallbewilligung (B-Bewilligung) die Unterzeichnung einer Reueerklärung beim eritreischen Konsulat in der Schweiz zu verlangen.
Die SFH begrüsst dieses Urteil, worin höchstrichterlich festgehalten wird, was die SFH schon lange fordert: Die Schweizer Behörden müssen sicherstellen, dass die Erteilung einer Härtefallbewilligung auf den im Schweizer Recht festgelegten Bedingungen beruht und nicht auf einer von einem anderen Staat verlangten Selbstbelastung. Die SFH fordert, dass auch für alle anderen Konstellationen, wie z.B. Familiennachzug, Auslandreisen oder Eheschliessung, von der Passbeschaffungspflicht abgesehen wird. Sie wird die Praxis in Bezug auf Personen aus Eritrea weiterhin aufmerksam verfolgen.
Schutzquote
Die meisten Asylsuchenden aus Eritrea erhalten entweder den Status als anerkannte Flüchtlinge oder den Status der vorläufigen Aufnahme. Im Jahr 2024 (Stand Ende Oktober) haben laut Angaben des SEM in insgesamt 1767 erledigten Fällen 1018 Eritreerinnen und Eritreer Asyl erhalten, 310 wurde eine vorläufige Aufnahme gewährt. Die Schutzquote (Anteil der Asylgewährungen plus vorläufige Aufnahmen zum Total aller Erledigungen) betrug damit 77.6%.
Da Zwangsrückführungen nach Eritrea nicht durchführbar sind, landet seit der verschärften Wegweisungspraxis eine wachsende Anzahl von Personen in der Nothilfe und muss in einer äusserst prekären Situation leben.
Dafür setzen wir uns ein
- Aktuelle Entwicklungen und Informationslage müssen bei Asylentscheiden genügend berücksichtigt werden: Seit 2016 führen die illegale Ausreise und die drohende Zwangsrekrutierung bei Asylsuchenden aus Eritrea nicht mehr automatisch zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft. Ausserdem schätzen die Schweizer Behörden den Wegweisungsvollzug ins Herkunftsland grundsätzlich als zumutbar ein. Diese Praxisverschärfungen sind aus Sicht der SFH angesichts der problematischen Situation im Land und der unsicheren Informationslage nicht gerechtfertigt. Der UNO-Antifolterausschuss hat in mehreren Fällen Wegweisungen aus der Schweiz nach Eritrea gestoppt, weil diese gegen das Refoulement-Verbot verstossen würden (CAT-Entscheide Nr. 983/2020 vom 9. Mai 2023, Nr. 887/2018 vom 22. Juli 2022, Nr. 914/2019 vom 28. April 2022, Nr. 872/2018 vom 28. April 2022, Nr. 916/2019 vom 12. November 2021, Nr. 900/2018 vom 22. Juli 2021). Zudem geht aus einem aktuellen Urteil des Bundesgerichts (2C_64/2025 vom 20. November 2025) hervor, dass keine aktuellen, genauen und sachlichen Informationen zu Eritrea vorliegen, namentlich nicht zur Situation und Gefährdung von Personen, die endgültig nach Eritrea zurückkehren. Die Schweizer Asyl- und Wegweisungspraxis zu Eritrea muss dem Schutzgedanken stärker Rechnung tragen. Die Behörden dürfen sich nicht auf Kosten der Sicherheit der Betroffenen auf Mutmassungen oder nicht vorhandene gegenteilige/anderslautende Informationen stützen. Wo eine asylrelevante Verfolgung verneint wird oder aufgrund der unsicheren Informationslage nicht abschliessend beurteilt werden kann, ist eine vorläufige Aufnahme zu gewähren.
- Ausnahme von der Passbeschaffungspflicht: Eritreische Personen, die in der Schweiz nicht als Flüchtlinge anerkannt, aber vorläufig aufgenommen wurden oder einen negativen Entscheid mit Wegweisung erhalten haben, und keinen Pass besitzen, müssen bisher gemäss Schweizer Behörden für gewisse Bewilligungen und Zivilstandsänderungen einen solchen beim eritreischen Generalkonsulat in Genf beantragen. Dabei müssen sie eine sogenannte Reueerklärung unterzeichnen sowie die «Diasporasteuer» bezahlen. Gemäss einem neuen Bundesgerichtsurteil ist diese Passbeschaffungspflicht nicht zulässig. Die SFH fordert, dass die zuständigen Schweizer Behörden dieses Urteil im Zusammenhang mit Härtefallbewilligungen umsetzen und auch in allen anderen Konstellationen (Familiennachzug, Auslandreisen, Eheschliessung etc.) von der Passbeschaffungspflicht für eritreische Personen absehen. Stattdessen soll ihnen ein Pass für ausländische Personen ausgestellt werden.
- Ausbau der Regularisierungsmöglichkeiten: Zwangsrückführungen nach Eritrea sind nicht durchführbar. Trotzdem wurde in der Schweiz die Wegweisungspraxis verschärft. Immer mehr Eritreerinnen und Eritreer müssen deshalb Nothilfe beanspruchen und in einer besonders prekären Situation leben. Die Regularisierungsmöglichkeiten für den Aufenthalt von Personen, die längerfristig nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren können, müssen ausgebaut werden.