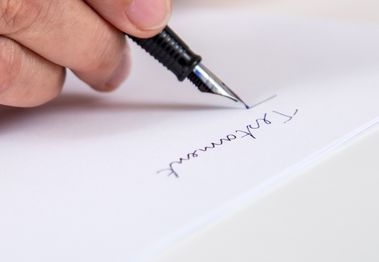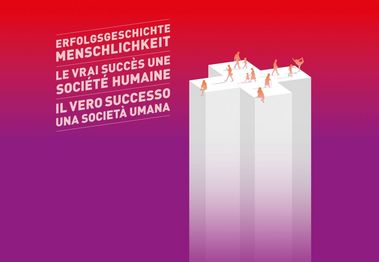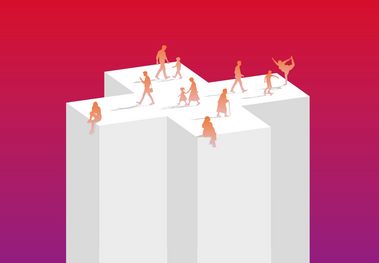«Der Lohn für unsere Bemühungen ist das positive Feedback, das wir von den Asylsuchenden erhalten»
In einem Bericht, den Alt-Bundesrichter Oberholzer 2021 nach dem Bekanntwerden von Gewaltvorfällen in Bundesasylzentren verfasst hatte, wurden unter anderem Weiterbildungen für Mitarbeitende von Sicherheitsfirmen empfohlen. Das Bildungsteam der Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH) hat bereits mehr als 100 Schulungen in transkultureller Kompetenz für Sicherheitsmitarbeitende, die in Bundesasylzentren arbeiten, durchgeführt. Nun wurde das Kurskonzept in Absprache mit dem Staatssekretariat für Migration und den involvierten Sicherheitsfirmen methodisch und inhaltlich weiterentwickelt.
Von Annelies Müller, Redaktorin SFH
Seit 2024 besteht die Weiterbildung «Transkulturelle Kompetenz für Sicherheitsmitarbeitende in Bundesasylzentren (BAZ)» aus anderthalb Tagen Präsenzunterricht und einem ergänzenden halbtägigen E-Learning-Modul.
Welchen Unterschied es macht, wenn Sicherheitsmitarbeitende im Arbeitsalltag empathisch und transkulturell kompetent handeln, haben mir Muzafer Bisevac, Sektorchef Marketing und Operation am Securitas-Standort Olten, und Marianna Trgina, Leiterin des Teams Sicherheit im Bundesasylzentrum Flumental/SO, erläutert.
Muzafer Bisevac und Marianna Trgina verfügen zwar selbst nicht über Fluchterfahrung, haben jedoch beide einen Migrationshintergrund. Bisevac stammt aus Bosnien. Sein Vater kam während der 70er Jahre als Gastarbeiter in die Schweiz. «Während des Krieges waren wir aber durch viele Bekannte und Familienmitglieder sehr involviert. Diese Erfahrungen mit Kriegsvertriebenen helfen mir heute noch im Asylbereich.» «Ich bin aus meiner Heimat Slowakei ausgewandert, dies aber aus eigenem Antrieb,» berichtet Trgina. «Als ich ankam, war es sehr schwierig.» Trotzdem ist sie geblieben und sagt über ihre Erwartungen vor dem ersten Kursbesuch: «Mir war gar nicht klar, was transkulturelle Kompetenz überhaupt bedeutet. Ich habe zwar zwanzig Jahre in der Gastronomie gearbeitet, in einer sehr multikulturellen Branche also, und auch bei der Securitas arbeiten Leute aus diversen Kulturen. Wir leben das im Alltag einfach, aber es war uns vor dem Kursbesuch nicht bewusst.» Ihr Kollege Bisevac ist seit 2009 in der Sicherheitsbranche tätig. «Da hat man es immer wieder mit Leuten aus verschiedenen Kulturen zu tun. Die meisten Mitarbeiter und Klienten, die uns im Bereich Sicherheit begegnen, sind aber im Gegensatz zu den Asylsuchenden schon länger hier.»
Nach ihren ersten Kurseindrücken befragt, erinnert sich Trgina: «Für mich bestand das grösste Aha-Erlebnis darin, zu erfahren, wie lange eine Flucht dauern kann. Ich dachte immer, das ist eine Entscheidung, man steigt ins Flugzeug, kommt an, und dann geht das Leben weiter. Im Kurs erzählte uns eine Frau, dass sie auf ihrer Flucht zwei Kinder geboren, also mit anderen Worten eine Familie gegründet hat. Wir hören immer von den Schlauchbooten, aber das ist meist nur die letzte Fluchtetappe.»
Bisevac hat beeindruckt, dass es, wie er im Kurs gelernt hat, in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Konzepte von Nähe und Distanz gibt. «So wird hier in der Schweiz eine grössere körperliche Distanz zum Gegenüber eingehalten als anderswo. Auch Berührungen sind hierzulande nicht üblich.»
Zurück im Berufsalltag. In welcher Situation konnten die beiden Sicherheitsmitarbeitenden das im Kurs gelernte Wissen erstmals praktisch anwenden? «Bei mir war es ein Konflikt. Also eigentlich war es nur auf den ersten Blick ein Konflikt», erinnert sich Bisevac. «Zwei Männer sprachen lautstark miteinander, fast so, als ob sie Streit hätten. Doch das hatten wir im Kurs thematisiert. Also ging ich auf die Männer zu und fragte: «Ist bei Ihnen alles in Ordnung?» Beide bestätigten es. Früher wäre ich dazwischengegangen, oder ich hätte zumindest energisch gefragt: «Hey! Was ist los?» Damit hätte ich den Konflikt aber möglicherweise noch angeheizt, weil meine Reaktion sie verwirrt hätte.»
«Die Kommunikation wird einfacher. Wenn wir wissen, wie wir bestimmte Gesten und Situationen einordnen müssen, kommt es weniger zu Konflikten», erklärt Trgina. Sie habe gelernt, ihre Rolle als Frau und die Reaktionen der Asylsuchenden auf sie anders zu bewerten: «Wenn ich ihnen eine Anweisung gebe oder einfach nur kommunizieren will, dann sehen sie mir oft nicht in die Augen, oder sie geben mir nicht die Hand. Vor dem Kurs habe ich das als respektlos empfunden.» Sie habe früher viel mit den Händen kommuniziert, führt Trgina weiter aus. Das sei zum Teil aber als offensiv wahrgenommen worden. «Beispielsweise bedeutet das Handzeichen für OK im arabischen Raum: «Du bist eine Null».»
«Genau», pflichtet ihr Bisevac bei. «Auch das Daumenhoch ist in gewissen Kulturen eine obszöne Geste. Oder das sich mit Daumen und Zeigefinger über den Kiefer Streichen ist im Arabischen eine Drohgebärde. Ich mache es zuweilen noch immer unbewusst, wenn ich nachdenke, aber in der Kommunikation mit Asylsuchenden ist das nicht wirklich zielführend. Es ist jedoch gar nicht so einfach, solche nonverbalen Gesten wegzulassen, weil viele Dinge automatisiert sind.»
Nach dem Kurs habe er begonnen, ein Ordnungsdiensthandbuch zu verfassen. Darin habe er solche «Stolperfallen»-Situationen aufgeführt. «Als Mariannas Vorgänger war ich bis Ende Juni 2023 Leiter des Sicherheitsteams im BAZ Flumental. Von dort aus haben wir unsere Erfahrungen mit dem SEM ausgetauscht. Wir gehen auch an die Öffentlichkeit, indem wir alle drei Monate einen Newsletter publizieren. Marianna und ich gaben darin ein Interview zu unseren Erfahrungen mit transkultureller Kompetenz.
Ihr Erfolgsrezept bestehedarin, dass das Team Sicherheit einen engen Austausch mit dem Betreuungsteam pflege. Dieser Austausch finde leider nicht in allen Bundesasylzentren gleichermassen statt. Sie aber haben so die Konfliktprävention stetig weiter entwickeln und darauf aufbauend eine Praxis der Konfliktpräventionsbetreuung erarbeiten können: «Das Prinzip ist relativ simpel. Gemäss einer Weisung des SEM dürfen zum Beispiel keine Getränke in Aluminiumdosen oder verderbliche Lebensmittel in die Zentren gebracht werden; Letzteres aus Hygienegründen, Ersteres wegen der Selbst- und Fremdverletzungsgefahr. In vielen BAZ werden solche Getränke oder Esswaren vom Sicherheitspersonal deshalb am Eingang einkassiert. Wir aber bieten den Bewohnenden einen Becher oder Löffel sowie einen warmen Ort an, um Konflikte deswegen zu vermeiden.»
Um den Bedürfnissen der Menschen besser gerecht werden zu können, habe man im Baz Flumental auch eine neue Ausgangszeitenregelung gefunden. «Von Ausgangszeiten bin ich persönlich überhaupt kein Fan, denn Asylsuchende sind ja erwachsene Menschen. Ich habe deshalb versucht, die Zeiten, die anfänglich nur bis 17h dauerten, nach hinten zu schieben.», erklärt Bisevac . Doch gewisse Ortsansässige hätten sich daran gestört, wenn die Geflüchteten draussen herumliefen, denn es war in der Gegend zu einigen Einbrüchen gekommen. «Im Team konnten wir nun durchsetzen, dass gratis ein Shuttlebus nach Solothurn vom SEM eingerichtet worden ist. Der fährt jede Stunde bis um 20h. Das dient nicht zuletzt der internen Konfliktprävention, denn müssten sie um 17 Uhr im Zentrum sein, dann erhöhte sich damit das Risiko von Streitereien. So aber können die Asylsuchenden in Solothurn spazieren gehen oder sich dort im Sommer an die Aare setzen.»
«Der Lohn für unsere Bemühungen ist das positive Feedback, das wir von den Asylsuchenden erhalten. Sie fragen uns manchmal, wo sie etwas kaufen gehen oder ob sie einen Ortsplan haben könnten. Wenn wir ihnen vom Sicherheitspersonal mit solch kleinen Dienstleistungen entgegenkommen, dann verändert sich dadurch ihr Bild von uns. Eine Uniform signalisiert dann nicht mehr «GEFAHR!», sondern sie bedeutet «Hilfestellung.». Diesen Status haben wir mittlerweile in Flumental», berichtet Trgina.
Bisevac resümiert: «Ich finde es schön, dass wir mit dem Kurs näher an die Geflüchteten herangeführt werden und dass man im Gegenzug versucht, ihnen auch uns näherzubringen.» Selbstverständlich gebe es Asylsuchende, die das Sicherheitspersonal auf Trab hielten. Das seien aber maximal 10%», ergänzt Bisevac. «Erst kürzlich wurde einem unserer Mitarbeiter ein Zahn ausgeschlagen. Den Mann muss Marianna nun jetzt sorgfältig betreuen, damit er diese negative Erfahrung nicht verallgemeinert. Ich sage meinen Leuten immer: Wir müssen uns auf die mehr als 90% der Geflüchteten konzentrieren, die sich kooperativ verhalten.»
Auf die Frage, ob sie den SFH-Kurs anderen Berufskolleg*innen empfehlen würden, fällt die Antwort eindeutig aus: «Unbedingt! Von den Kursinhalten kann man sowohl im beruflichen wie auch im privaten Alltag profitieren.»