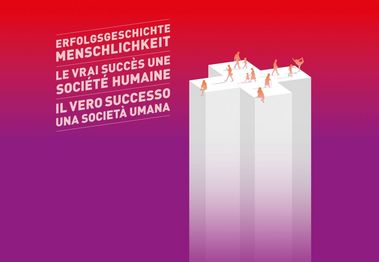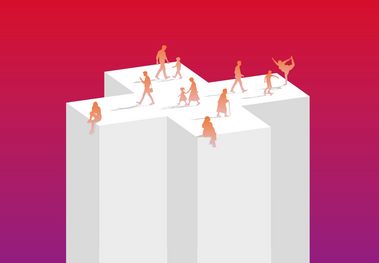Lucia Della Torre, Juristin
Einleitung
Seit den Angriffen vom 7. Oktober 2023 hat sich die Lage in Gaza dramatisch verschärft. Heute erreichen uns Tag für Tag erschütternde Berichte von zivilen Opfern, Frauen, Männer und Kinder, die im Gazastreifen jeglicher Lebensgrundlage und jeglichen Schutzes beraubt sind. Die grausamen Bilder sind allgegenwärtig. Das war auch bei vielen anderen humanitären Krisen vor dieser der Fall, wie zum Beispiel jener in Afghanistan. Oder in der Ukraine und davor in Syrien oder am Balkan. Früher oder später haben diese Krisen unser Leben auf die eine oder andere Weise berührt und wurden Teil unserer Realität. Die Menschen flohen, überquerten Grenzen, kamen nach Europa und auch in die Schweiz. Und wer wollte, konnte etwas tun: Unterstützung anbieten, Schutz gewähren, Solidarität zeigen.
Im Fall der von Krieg und einer akuten Hungersnot bedrohten Menschen im Gazastreifen ist das anders. Nur wenigen gelingt die Flucht. Und es scheint nahezu unmöglich, in die Schweiz zu kommen. Bei vielen Menschen ist das Gefühl der Ohnmacht gross, denn es entsteht der Eindruck, nichts tun zu können für die Palästinenser*innen in Gaza.
Als Organisation, die sich dafür einsetzt, dass die Schweiz geflüchteten und vertriebenen Menschen Schutz gewährt, wollen wir deutlich machen, welche Möglichkeiten es zusätzlich zu der notwendigen humanitären Hilfe vor Ort gibt. Denn das Schweizer Recht sieht durchaus Instrumente vor, die genutzt werden können, um die Rechte der schutzsuchenden Palästinenser*innen aus dem Gazastreifen, so weit als möglich zu gewährleisten. Dieser Artikel will aufzeigen, um welche Instrumente es sich dabei handelt.
Humanitäre Visa verstärkt nutzen und ausbauen
Das humanitäre Visum wurde eingeführt, um Menschen, die an Leib und Leben gefährdet sind, eine sichere Einreise in die Schweiz zu ermöglichen, damit sie hier einen Antrag auf internationalen Schutz stellen können. Der Antrag auf ein humanitäres Visum muss bei einer Schweizer Botschaft im Ausland eingereicht werden. Falls es im Herkunftsland der gefährdeten Person keine Schweizer Botschaft gibt, kann der Antrag auch in einem Drittstaat eingereicht werden, wo es eine solche gibt.
Wie bereits erläutert, gelingt es nur sehr wenigen Menschen aus dem Gazastreifen, diesen überhaupt zu verlassen. Diejenigen, die es schaffen, halten sich vor allem in Jordanien oder Ägypten auf – unter äusserst schwierigen und prekären Bedingungen. Besonders betroffen sind vulnerable Gruppen wie Frauen, Kinder, ältere Menschen und Kranke. Die Schweiz unterhält in beiden Staaten konsularische und diplomatische Vertretungen. Die SFH ersucht den Bund, diesen Personen grosszügig humanitäre Visa zu gewähren, damit sie, nachdem sie aus ihrem Heimatland geflohen sind, wo sie bereits unvorstellbare Gewalt erlitten haben, zumindest sicher in die Schweiz kommen und internationalen Schutz beantragen können.
Schutz für alle Palästinenser*innen in der Schweiz
Viele Palästinenser*innen besitzen keine Staatsangehörigkeit und gelten somit als staatenlos. Die meisten von ihnen leben in Syrien, dem Libanon, Jordanien, im Westjordanland und natürlich im Gazastreifen. Die UNRWA, das Hilfswerk der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge, ist in all diesen Ländern tätig. Aufgrund des Schutzes, den die UNRWA Palästinenser*innen in diesen Gebieten gewährt, sind sie von der Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention und der Übereinkommen zur Staatenlosigkeit ausgeschlossen.
Verlässt eine dieser Personen jedoch die zuvor genannten Gebiete, um in der Schweiz Schutz zu suchen, und wird eine Wegweisung in diese Länder als undurchführbar erachtet, so hat sie nicht nur Anspruch auf eine vorläufige Aufnahme, sondern muss zudem als staatenlos anerkannt werden, da sie sich nicht mehr unter den Schutz der UNRWA stellen kann. Das Bundesgericht hat diese Frage vor einigen Jahren im Fall eines Palästinensers aus Syrien (eine Wegweisung dorthin gilt als unzumutbar) geklärt.
Nach Ansicht der SFH sollte diese Praxis angesichts der aktuellen Lage ohne Zweifel für alle palästinensischen Geflüchteten aus dem Gazastreifen zur Anwendung kommen. Die Anerkennung als Staatenlose*r würde einen rechtlich stabileren und umfassenderen Schutz bieten als die vorläufige Aufnahme.
Schliesslich ist angesichts der Rechtsprechung des EuGH und der Nachbarländer auch in der Schweiz zu prüfen, ob Palästinenser*innen, die aus dem Gazastreifen fliehen, als Flüchtlinge anerkannt werden können. Nicht nur die tatsächliche Fähigkeit der UNRWA, die palästinensischen UNRWA-Flüchtlinge in Gaza zu schützen und zu unterstützen, ist mittlerweile ernsthaft in Frage zu stellen. Es lässt sich auch argumentieren, dass Palästinenser*innen aus Gaza einer Verfolgung aus relevanten Gründen im Sinne des Asylrechts ausgesetzt sind.
Schlussfolgerung
Wie Susan Sontag schrieb: «Mitgefühl ist eine instabile Emotion, die sich in Taten niederschlagen muss, um nicht zu verkümmern. Wenn man das Gefühl hat, dass «wir» nichts tun können und «sie» auch nichts tun können, dann beginnt man, sich zu langweilen, zynisch und apathisch zu werden. Passivität macht gefühllos.»
Lassen wir das Mitgefühl, das wir empfinden, wenn wir die Bilder aus dem Gazastreifen sehen, nicht verkümmern. Werden wir nicht gleichgültig, zynisch oder apathisch.
Es ist unsere Pflicht, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Geflüchtete aus Gaza den notwendigen Schutz und einen sicheren Aufenthaltsstatus erhalten.
Wegzuschauen ist eine Entscheidung. Zu handeln auch. In einer Welt, in der Gleichgültigkeit leichtfällt, ist es ein menschlicher und politischer Akt, Verantwortung zu übernehmen.